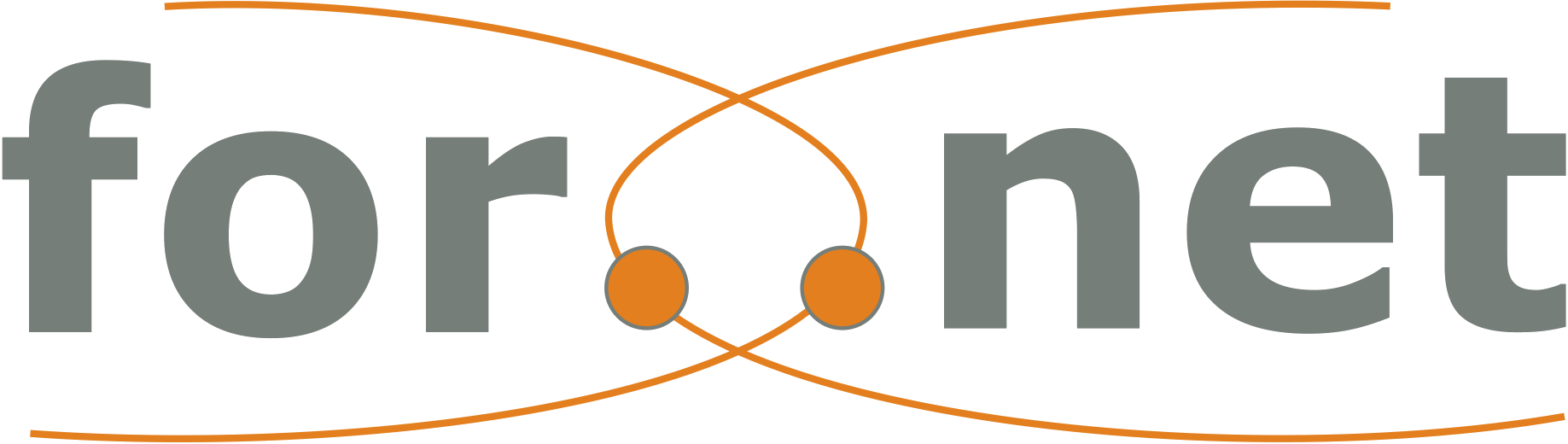Software zu entwickeln und zu warten ist ein aufwändiges Unterfangen, das sowohl Zeit als auch finanzielle Ressourcen in Anspruch nimmt. Doch gerade digitale Produkte können verhältnismäßig leicht kopiert werden, das Interesse an einem rechtlichen Schutz ist dementsprechend verständlicherweise groß. Zu der Frage, ob und in welchem Umfang Software patentierbar ist, kursieren viele widersprüchliche – und teils schlicht falsche – Meinungen. § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG scheint deutlich genug: „Programme für Datenverarbeitungsanlagen“ werden nicht als Erfindungen im Sinne des Abs. 1 angesehen. Doch gemäß Abs. 4 gilt dies nur, soweit „für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird“. Doch was bedeutet dies im Ergebnis für Software?
Schutzfähigkeit von Software
Software, also Computerprogramme, stellt eine vorgegebene Befehlsfolge dar, die von einem Computer ausgeführt wird und dabei i.d.R. bestimmte Eingabewerte verarbeitet und daraus Ausgabewerte produziert.[1] Wenn auch der Begriff „Softwarepatent“ als missverständlich angesehen wird, so hat er sich doch im Sprachgebrauch durchgesetzt. Für eine schutzfähige technische Erfindung ist grundsätzlich nötig, dass sie auf die reale, physische Welt Einfluss nimmt und so dem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte entspricht, also beispielsweise Hardware steuert.[2] Nur dann liegt mehr als ein Programm „als solches“ vor.
Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) stellt klar: Nur, wenn eine computerimplementierte Erfindung eine abstrakt formulierte Lösung des zugrunde liegenden technischen Problems mit technischen Mitteln angibt – also eine abstrakt formulierte technische Lehre darstellt – sowie neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kommt ein Patent infrage.[3] Ein zentraler Aspekt ist dabei die „technische Lehre“ – die Idee allein genügt nicht, es muss darüber hinaus auf Basis der Idee eine „Lehre“ zum planmäßigen technischen Handeln formuliert werden. Ein Patent auf ein Programm ohne einen technischen Bezug – d.h. (nur) auf einen konkreten Programmcode – scheidet aus.
Deutlicher wird dies anhand von Beispielen: Eine App wie Snapchat, die lediglich ein Bedürfnis der Nutzer – Bilder spontan mit Bekannten zu teilen – erfüllt, löst z.B. kein technisches Problem und ist daher nicht patentierbar.[4] Dagegen kann eine App, die technisch sicherstellt, dass der Empfänger ein versandtes Bild nicht speichern kann (etwa als Screenshot), sehr wohl mit einem Patent geschützt werden, da auf technische Bedingungen des Empfangsgerätes eingegangen wird.
Der BGH geht dabei von der folgenden Prüfungsreihenfolge aus:[5]
- Technizität: Liegt der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet?
- Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln: Stellt der Gegenstand nicht lediglich ein Programm für Datenbankverarbeitungsanlagen als solches dar?
- Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
Können alle drei Fragen im Prüfprogramm bejaht werden, kommt ein Patent in Frage.
Europäisches Patentamt (EPA): Auch Computersimulationen können „technischen Effekt“ aufweisen
Das Unternehmen Bentley Systems hatte einen Patentantrag eingereicht, mit dem eine Computersimulation geschützt werden sollte, die den Fluss mehrerer Fußgänger durch eine Umgebung wie ein Gebäude abbildet.[6] Dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) zufolge sind, ebenso wie in § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG, Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, da es sich dabei nicht um technische Erfindungen handelt. Der Auslegung des EPA zufolge können aber „technische Effekte“ schutzwürdig sein, die durch solche Programme erreicht werden.[7]
Die Große Beschwerdekammer stellte in ihrem Beschluss[8] fest, dass ein direkter Bezug eines beanspruchten Merkmals einer computerimplementierten Erfindung nicht immer nötig ist, sondern vielmehr technische Effekte auch innerhalb des computerimplementierten Prozesses auftreten können, etwa durch spezifische Anpassungen eines Rechners oder der Datenübertragung. „Reine Geschäftsmethoden“ sollen nach wie vor nicht patentierbar sein, sehr wohl jedoch softwaregestützte Verfahren, solange auch nur ein Element der Ansprüche einen technischen Charakter hat.[9] Damit reiht sich der Beschluss in die bisherige Linie der Behörde ein und erweitert diese um reine Designlösungen. Die Vergabepraxis des EPA stößt immer wieder auf Kritik, unter anderem weil dadurch der Kerngehalt des EPÜ ausgehöhlt werde und nicht genügend Rechtssicherheit für Programmierer gewährleistet werde.[10]
Fazit
Gerade mit Blick auf die Bedeutung der Innovation im Software-Bereich und die digitale Souveränität in Europa ist die Möglichkeit, die eigene Entwicklung schützen lassen zu können, von großer Relevanz. Die in diesem Bereich in den vergangenen Jahren insbesondere vom EPA vermehrt erteilten Patente für Computerprogramme werden zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von Firmen und Einzelpersonen aus den USA und Asien gehalten.[11] Die Praxis des EPA, unter anderem durch entsprechende Leitlinien formalisiert, soll es erleichtern, in Europa Patente auf Machine Learning oder Cloud Computing zu erhalten.[12] Im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz führt die grundlegende Eigenschaft, selbständig weitere Lernprozesse zu durchlaufen, zu einem weiteren Problem: Die Patentierbarkeit scheitert nicht nur daran, dass noch kein technisches Ergebnis vorliegt, sondern auch daran, dass derartige Programme nicht auf einer (menschlichen) Erfindung beruhen, sondern vielmehr eine Folge des Einsatzes der KI sind.[13]
Ob jedoch unabhängig von der Möglichkeit, ein Programm patentieren zu lassen, der Patentschutz die richtige Wahl ist, muss jeweils einzelfallbezogen beurteilt werden. Dabei ist nicht nur der unter Umständen erhebliche finanzielle Aufwand zu bedenken, sondern auch die Tatsache, dass der Quellcode im Rahmen des Patentverfahrens offengelegt werden muss. Auch das Urheber-, Wettbewerbs- und Markenrecht sowie nicht zuletzt vertragliche Vereinbarungen kommen infrage, um Software angemessen zu schützen.
[1] Vgl. Sabellek, in: Schuster/Grützmacher, IT-Recht, 2020, § 1 PatG Rn. 91.
[2] Vgl. zur Definition BGH GRUR 1969, 672.
[3] DPMA, Computerimplementierte Erfindungen, Stand: 10.08.2019, dort auch zum Folgenden.
[4] Vgl. Schindler, WIM 9/2020, 38, 40, dort auch zum Folgenden.
[5] Vgl. Sabellek, in: Schuster/Grützmacher, IT-Recht, 2020, § 1 PatG Rn. 96 ff. (m.w.N.).
[6] Vgl. Krempl, Europäisches Patentamt dreht weiter an der Softwarepatent-Schraube, Heise Online, 13.03.2021, dort auch zum Folgenden.
[7] Krempl, Europäisches Patentamt dreht weiter an der Softwarepatent-Schraube, Heise Online, 13.03.2021.
[8] EPA, Beschl. v. 10.03.2021 – G 0001/19.
[9] Krempl, Europäisches Patentamt dreht weiter an der Softwarepatent-Schraube, Heise Online, 13.03.2021.
[10] Vgl. Krempl, Europäisches Patentamt verteidigt Vergabe von Softwarepatenten, Heise Online, 29.04.2009.
[11] Vgl. Krempl, Patentanmeldungen für „smarte Objekte“ wachsen rasant in Europa, Heise Online, 11.12.2017.
[12] Vgl. Krempl, Europäisches Patentamt erleichtert Ansprüche auf Cloud Computing, Heise Online, 08.10.2018.
[13] So Prof. Dr. Mary-Rose McGuire während der Carl Heymanns Patenttage im Juni 2019, vgl. Claessen, IPRB 2019, 201, 201.
Sämtliche Links wurden zuletzt am 16.03.2021 abgerufen.